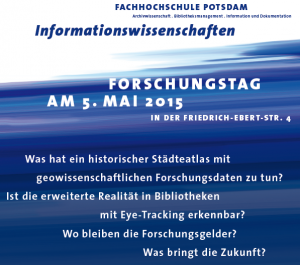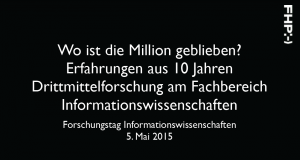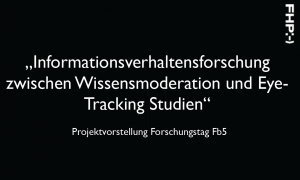Es ist für einen Autor immer ein besonderer Moment, zu lesen, wie Leser den eigenen Text aufgenommen haben und beurteilen, und ob sie das Buch anderen empfehlen.
Es ist für einen Autor immer ein besonderer Moment, zu lesen, wie Leser den eigenen Text aufgenommen haben und beurteilen, und ob sie das Buch anderen empfehlen.
Die erste Lektüre meines Buches wurde dankenswerterweise bereits kurz nach der Veröffentlichung im Wintersemester 2024/25 an der Hochschule Darmstadt von Luzian Weisel (Honorarprofessor für „Information Behaviour“) in einem Masterseminar organisiert. Eine Gruppe von Studierenden erhielt als Seminaraufgabe, das Buch zu lesen und zu rezensieren. Das Ergebnis wurde in Information. Wissenschaft und Praxis im Bereich Newcomer“ mit einem Vorwort von Luzian Weizel als „kollaborative Buchkritik“ veröffentlicht [1]. Der Mut der Studierenden, sich diesem umfangreichen Werk zu widmen, ist wirklich zu bewundern. Naturgemäß hat sich das Dreierteam die Aufgabe aufgeteilt und jeweils auf Teile daraus konzentriert. Daraus folgt z.B. der Vorwurf, der Autor hätte nicht gegendert, was ich jedoch eingangs erläutert hatte. Auch wurde kritisiert, das Buch eigne sich nicht als Lehrbuch und sei für Studierende zu kompliziert. Es ist schade, dass diese Kommentare als Negativeindruck eine Lektüre in einem führenden Fachjournal im Raum stehen bleiben. In der Tat werden vom Verlag auch Studierende als Zielgruppe des Buches genannt, aber in erster Linie ist es doch eher ein transdisziplinärer Beitrag für eine sehr weitgehende wissenschaftliche Diskussion, von der ich aus leidvoller Erfahrung annehmen muss, dass Studierende in den aktuellen informationswissenschaftlichen Curricula selbst im Masterstudium an Hochschulen für angewandte Wissenschaft überfordert sein werden, da doch viele Fachdiskurse aus unterschiedlichen Disziplinen, die ich aufgreife, mehr Hintergrundwissen erfordern, als in den kurzen angewandten Studienabläufen vermittelt werden können. Insofern ist das Buch eher eine Anregung für zukünftige Curricula.
Interessant ist auch das Monitum der Rezensenten, der Autor würde nicht genau genug auf die Quellen referenzieren. Wäre ich auf jede Zentralargumentation eines erwähnten Buches im Einzelnen eingegangen (z.B. der „pauschale“ Hinweis (S: 206) auf Knorr-Cetina: „Die Fabrikation von Erkenntnis“ als Erläuterung des Konzeptes der „material agency“ in der Praxistheorie), dann hätten 444 Seiten bei weitem nicht ausgereicht (mit Seitenangaben wird ja auch üblicherweise nur referenziert, wenn konkrete Passagen oder Textteile genutzt werden, aber das ist dann eher eine Aufforderung an Plagiatsjäger…).
Dennoch gelingt den Studierenden ein sehr guter und ausführlicher Überblick über das Buch und die zentrale Aussage, es handele sich nicht um ein Lehrbuch, wird gut herausgearbeitet. Im aktuellen Sommersemester bekam ich allerdings unerwartet die Gelegenheit, das Buch doch auch selber in einem Bachelorseminar als Lehrmaterial einzusetzen. Natürlich ist es anspruchsvoll, aber mit einordnender Begleitvorlesung habe ich zumindest subjektiv den Eindruck, dass auch Studierende ohne große akademische Vorkenntnisse einiges mit dem Buch und der neuen Sicht auf das Thema anfangen können. Zumindest wenn es auf die aktuelle Lebenswelt der Studierenden bezogen wird in der Rezeption.
Dass das Buch jedoch fachlich die intendierte Wirkung zeigt und von Experten tiefergehend verstanden wird, zeigt dann die aktuelle Rezension von Joachim Griesbaum (Universität Hildesheim) in Bibliothek. Forschung und Praxis [2]. Die beeindruckend ausführlich und gut geschriebene Rezension gibt zunächst einen korrekten und detailreichen Einblick in den Ablauf des Buches und resümiert folgendermaßen:
Insgesamt ist das Werk gerade durch den über das engere Fach hinausgreifenden Blickwinkel vielfältig, komplex und lohnenswert. Das Wissen des Autors ist beeindruckend. Aus der Sicht des Rezensenten ist das Werk ein Glücksfall für die Informationswissenschaft, da es in gelungener Weise eine Vielzahl an Literatur und Perspektiven zusammenführt und sehr gelungen synthetisiert. Gerade das interdisziplinäre Herangehen ist ein zentraler Aspekt, der das Buch für Informationswissenschaftler:innen besonders lesenswert macht. Besonders spannend sind für den Rezensenten die Ausführungen zur menschlichen Informationsverarbeitung im Gehirn bzw. im Gedächtnis.
Das Buch ist durch seine vielfältigen Perspektiven und Wissensressourcen sehr inhaltsreich und „dicht“, was das Lesen stellenweise anspruchsvoll macht. Dies zeigt sich zunächst an einer sehr hohen Zitationsdichte. Leser:innen werden oft in kurzer Folge mit zahlreichen unterschiedlichen Quellen konfrontiert, die alle verstanden sein wollen, was bisweilen anstrengend sein kann.
Mitunter verlaufen Argumentationsstränge etwas unsystematisch, so beispielsweise ab dem Kapitel „Serendipität“ im Teil 3, Abschnitt „Finden“. Dies ist dem Autor jedoch nicht anzulasten. Vielmehr verdient er Anerkennung dafür, dass er weit über das eigentliche Kerngebiet der Informationswissenschaft hinausgeht und dieses Wissen mit zentralen Themen der Informationswissenschaft sowie des Informationsverhaltens verknüpft.
Das Buch ist keine „leichte“ Lektüre. Gelegentlich wird es inhaltlich sehr anspruchsvoll. So wird beispielsweise im Kapitel „Praxis“ versucht, Information und insbesondere Informationsverhalten aus einer ontologischen Perspektive auf unterschiedlichen sozialen Ebenen im Spannungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft (Mikro-, Makroebene) zu beleuchten. Hierzu werden zahlreiche Autoren und Erklärungsansätze aus Ökonomik, Soziologie und Philosophie herangezogen, was ein äußerst komplexes Bild ergibt. Dennoch lohnt es sich, sich durchzuarbeiten.
Hobohm stellt den Leser:innen in jedem Kapitel „Kernsätze“ bereit. Diese fassen zentrale Aspekte der jeweiligen Kapitel prägnant zusammen. Vielleicht wäre es für Leser:innen hilfreich, diese bereits vor dem eigentlichen Lesen der Kapitel zu rezipieren, um eine Struktur zur Verarbeitung der Inhalte zu erhalten. Dies erscheint dem Rezensenten als sehr guter Ansatz, um die angesprochene Komplexität für die Leser:innen handhabbar zu machen.
Nach Einschätzung des Rezensenten hat das Werk insgesamt einen hohen Wissenswert. Hobohm präsentiert sich in Informationsverhalten im besten Sinne als Wissenschaftler mit einem weiten Blick. Die Informationswissenschaft kann aus dem dargelegten Wissen zahlreiche Impulse ziehen. Es wäre wünschenswert, wenn das Werk auch in einer englischsprachigen Version erscheinen würde, um es einem noch größeren Leserkreis zugänglich zu machen.
Trotz dieses langes Zitats sei der Gesamttext der Rezension zur Lektüre empfohlen, der „ahead of print“ open access zur Verfügung steht. Ich werde diese Rezension als Musterbeispiel in meinem aktuellen Seminar zur Wissenschaftssoziologie verwenden… Eine weitere Besprechung ist derzeit in Vorbereitung für Information. Wissenschaft &Praxis. Die Autorin, Anne-Katharina Weilenmann, nennt darin – wie ich hörte – das Buch Informationsverhalten „ein beeindruckendes und faszinierendes Werk“. Wir dürfen gespannt sein auf die Publikation der Rezension.
Schön wäre es natürlich nun auch Besprechungen aus dem nicht genuin informationswissenschaftlichen Kontext zu erhalten, vor allem weil ich ja in vielen fremden Feldern wildere. Über mögliche Hinweise auf interessierte Rezensenten wäre ich dankbar (es gibt noch Rezensionsexemplare).
[1] Cicek, Timucin, Schnell, Ines and Ulffers, Julia. „Kollaborative Rezension Informationsverhalten“ sowie „Einordnung einer Buchkritik durch den Informationsnachwuchs“ Information – Wissenschaft & Praxis, vol. 76, no. 2-3, 2025, pp. 137-142. https://doi.org/10.1515/iwp-2025-2009
[2] Griesbaum, Joachim. „Hans-Christoph Hobohm: Informationsverhalten. (Age of Access? Grundfragen der Informationsgesellschaft, Band 5). Berlin, Boston: De Gruyter Saur, 2024. 444 S., 28 Illustr. Online-Ausgabe: ISBN: 978-3-11-039618-8.“ Bibliothek. Forschung und Praxis, 2025. https://doi.org/10.1515/bfp-2024-0096 (aop)


 Am meisten hat mich persönlich der tiefe Blick in die Anthropologie und die Soziologie beschäftigt. Aber auch die Bearbeitung der wirtschaftswissenschaftlichen Grundfrage der Informationsasymmetrie oder der kognitionswissenschaftlichen Theorieentwicklung im Zusammenhang mit der KI Forschung am MIT war sehr spannend und hilfreich bei dem sich am Schluss schließenden Bogen der Informationsnutzung. Eine der faszinierendsten Erkenntnisse der Neurowissenschaft ist der Beleg dafür, dass menschliche Neugier, also die Suche nach Information, bzw. die Erwartung neue Information zu erreichen, Dopamin im Gehirn generiert und damit Information eine Droge ist.
Am meisten hat mich persönlich der tiefe Blick in die Anthropologie und die Soziologie beschäftigt. Aber auch die Bearbeitung der wirtschaftswissenschaftlichen Grundfrage der Informationsasymmetrie oder der kognitionswissenschaftlichen Theorieentwicklung im Zusammenhang mit der KI Forschung am MIT war sehr spannend und hilfreich bei dem sich am Schluss schließenden Bogen der Informationsnutzung. Eine der faszinierendsten Erkenntnisse der Neurowissenschaft ist der Beleg dafür, dass menschliche Neugier, also die Suche nach Information, bzw. die Erwartung neue Information zu erreichen, Dopamin im Gehirn generiert und damit Information eine Droge ist.