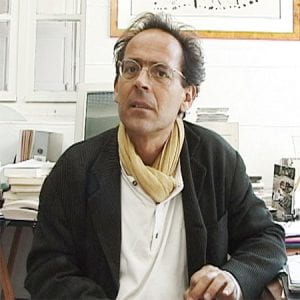Manche schreiben mit 91 noch das alles umfassende Opus Magnum ihres Lebens wie Jürgen Habermas [1], andere verlassen es freiwillig mit 68. Dies ist besonders schade bei dem neben Bruno Latour zweitwichtigsten aktuellen Philosophen Frankreichs.
Sein Buch „Logik der Sorge“ [2], eines der wenigen, die auf Deutsch erschienen, bekam in der Anfangszeit der Pandemie eine Art symbolische Aufladung, als klar wurde, dass die Sorge (lat. cura) ein vernachlässigter Aspekt unserer liberalitären Gesellschaft (wie er sagt) ist. In einem seiner letzten Bücher [3] erklärt er mit einem typisch französisch poststrukturalistischen Wortspiel à la Derrida sogar, dass „Wunden verbinden“ (panser) die gleiche Art des Handelns ist wie „denken“ (penser). Genauer hindenken bedeutet auch eine Form des Heilens bzw. muss sich ebenso wie der Krankenpfleger entscheiden, wer oder was „geheilt“ werden muss/kann im jeweiligen Moment. Ganz im Sinne auch der Definition“ von Information durch Gregory Bateson: „any difference that makes a difference“ [4].
Stiegler war Leiter des Collège international de philosophie, wo ich ihm in meiner Pariszeit in der 1980er Jahren leider noch nicht begegnet bin – jedenfalls nicht bewusst. Zuletzt war er Leiter des Institut de recherche et d’innovation, IRI am Centre Pompidou und hatte führende Positionen am IRCAM und am INA. Außerdem unterrichtete er an der TU Compiegne und ist in vielen öffentlichkeitswirksamen Aktivitäten der Zivilgesellschaft zu beobachten. Mehr geht nicht. Dennoch hätte ich mir eine weitere Begleitung unseres weiteren Weges in der Digitalität durch ihn gewünscht. Seine Gedanken kreisten immer wieder um das Verhältnis von Technik und Mensch und die Entwicklung der Gesellschaft. Ich denke, dass er weiter viel Einfluß auf Denken und Politik hätte haben können.
Wie der Titel seines Buches aus 2012 empfinde ich einen „État de choc“ – was er allerdings anders meinte und mit dem Untertitel deutlicher wird: „Bêtise et savoir au XXI siècle“ [5] (Dummheit und Wissen im 21. Jahrhundert). Insbesondere ist er mit seiner Fundamentalkritik des Anthropozän bekannt geworden mit dem Kunstbegriff des „Neganthropocene“ [6], in dem er Information (Shannons Negentropie) und Menschsein – ähnlich wie schon Schrödinger – verbindet. In seinen Vorträgen denkt man oft einem Informationswissenschaftler zuzuhören, wenn er über Entropie und Kybernetik, Shannon und Norbert Wiener, aber auch über Gestalt-Theorie und Gilbert Simondon spricht (vgl. eine seiner jüngsten Spuren bei Youtube [7])
Sein Werk ist rhizomatisch ausufernd und schwer zu verfolgen. Er ist der gleiche Schuljahrgang wie Deleuze und soll diesen stark beeinflusst haben. Er „schrieb“ seine vielen Bücher vorwiegend auf den Stau geprägten Autofahrten zur 80km weit entfernten Uni in ein Diktiergerät (o.ä.), was die Fülle aber auch Verzweigtheit seiner Texte etwas erklärt. In England hilft ihm sein Co-Autor und Übersetzer Daniel Ross zu einer Konkretisierung seines „Werks“. Anders als Habermas (aber mit diesem ist er nun wirklich nicht zu vergleichen!) hat er kein wirkliches Opus Magnum, dazu ist er auch zu sehr eine öffentlich agierende Persönlichkeit gewesen – ganz dem „Geist“ des Centre Pompidou entsprechend. „Berühmt“ geworden ist er durch sein „coming out“ als Bankräuber [8]. Es ist sicher pietätlos, aber er wird es mir verzeihen: ich fühle mich durch sein „Verschwinden“ („sa disparition„/Ableben) beraubt, gerade auch weil ich ihn erst kürzlich „entdeckt“ habe, wie gesagt um das Schlagwort „Sorge“ herum, dass ja z.B. Floridi mit der „Sorge um die Aufmerksamkeit“ im Onlife Manifesto [9] als eine ähnliche Gesellschaftskritik in die informationswissenschaftliche Diskussion einbrachte.
[1] Habermas, Jürgen (2019): Auch eine Geschichte der Philosophie. Bd. 1: Die okzidentale Konstellation von Glauben und Wissen. Bd. 2: Vernünftige Freiheit. Spuren des Diskures über Glauben und Wissen. 2 Bände. Berlin: Suhrkamp.
[2] Stiegler, Bernard (2008): Die Logik der Sorge. Verlust der Aufklärung durch Technik und Medien. Frankfurt am Main: Suhrkamp (edition unseld, 6).
[3] Stiegler, Bernard (2018): Qu’appelle-t-on panser. Paris: Éditions Les Liens qui libèrent.
[4] Bateson, Gregory (1979): Mind and nature. A necessary unity. New York: Dutton. S. 228: Glossar: „Information. Any diffrence that makes a differene“
[5] Stiegler, Bernard (2012): États de choc. Bêtise et savoir au XXIe siècle. Paris: Mille et une nuits.
[6] Stiegler, Bernard; Ross, Daniel (2018): The Neganthropocene. London: Open Humanities Press (CCC2 irreversibility).
[7] Séminaire Information et Entropie 20 Juin 2018 / 17h00 – 20h00 Centre Pompidou – Salle Triangle co-organisé par l’Institut de Recherche et d’Innovation et le projet NextLeap (EU H2020) (Youtube: https://youtu.be/3b9S-n1-7to)
[8 ] Stiegler, Bernard (2007): Zum Akt. Berlin: Merve-Verl. (Merve, 294).
[9] Floridi, Luciano (Hg.) (2015): The onlife manifesto. Being human in a hyperconnected era. [Report of the project „The Onlife Initiative: concept reengineering for rethinking societal concerns in the digital transition“ on behalf of DG Connect, the Euopean Commission Directorate General for Communications Networks, Content and Technology]. Cham, Heidelberg u.a.: Springer Open. Online verfügbar unter http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/onlife-initiative.